
Generative KI im Tourismus
Workshop für Praktiker
Die Welt ist immer stärker vernetzt und digitalisiert. Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet touristischen Unternehmen und Destinationen weitere Chancen ihre Aufgaben effizienter zu gestalten und zugleich die Sichtbarkeit im digitalen Umfeld zu verbessern. Zusätzlich bieten KI-Tools die Möglichkeit die Beratungs- und Servicequalität im Unternehmen zu steigern – auch in Zeiten knapper finanzieller und personeller Ressourcen.
Die angebotenen Workshops in den Jahren 2024 und 2025 boten den Praktikern der Tourismusbranche eine umfassende Einführung in den Umgang und die Potenziale von ChatGPT & Co im beruflichen Alltag touristischer Unternehmen, mit Fokus auf praktischen Anwendungsmöglichkeiten.
Wir lieferten den Teilnehmenden einen Einblick in die rasante Entwicklung generativer KI mit multimodalen Fähigkeiten (Text, Bild, Video) und eine grundlegende Einführung in die Funktionsweise von ChatGPT, Midjourney & Co. Auch eine Übersicht über die rechtlichen Aspekte zur Nutzung von ChatGPT & Co war Teil des Workshops.
AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus
Ein Verbundprojekt zur Entwicklung eines Digitalen Besuchermanagements in deutschen Tourismusdestinationen.

Das Projekt AIR hatte als übergeordnetes Ziel, durch die Entzerrung von Besucherströmen einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Tourismusentwicklung zu leisten. Konkret sollten solche AI-basierten Verfahren erforscht, entwickelt, implementiert und evaluiert werden, die helfen, die zeitweilige Überlastung von Reise- und Ausflugszielen durch gezielte Besucherinformation zu vermeiden und geeignete Alternativen aufzuzeigen.
Mehr zum Projekt und den Projektergebnissen finden Sie hier.
Das Projekt wird aus Mitteln des Programms “KI-Leuchttürme” des BMU teilfinanziert.
Laufzeit: 1.1.2022 bis 31.12.2024
Ansprechpartner am INIT: Prof. Dr. Robert Keller und Prof. Dr. Guido Sommer
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen: Marina Bergler,Franka Menke, Christiaan Niemeijer, Dominik Rebholz
FEB-NAFV - Flexibler Erlebnisbus (FEB) für nachhaltigen Freizeitverkehr
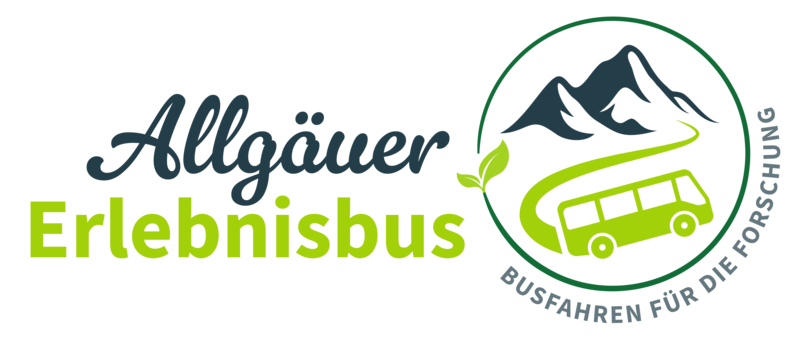
Die Ziele des Projekts waren durch die Entwicklung eines bedarfsorientierten und emissionsfreien Erlebnisbusses mit Pilotierung im Allgäu eine Reduzierung des Individualverkehrs und der damit verbundenen Emissionen im Freizeitverkehr sowie die Entlastung touristischer Hotspots zu erreichen. Dabei basierte das Konzept auf einer datengetriebenen Einsatz-, Routen- und Erlebnisplanung, inklusive eines fundierten Konzepts für Ladesäuleninfrastruktur. Ein besonderes Augenmerk lag in der Übertragbarkeit und Skalierbarkeit des Projekts auf andere Regionen sowie in der Funktion des Mobilitätsangebots als Besucherlenkungsinstrument im Allgäu.
Weitere Informationen zum Projekt und den Projektergebnissen findet sich hier.
Das Projekt FEB NAFV wird im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.
Laufzeit: 01.11.2021 bis 31.10.2024
Ansprechpartner am INIT:
Projektleitung: Prof. Dr. Robert Keller
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen: Jannika Eisele, Dr. Johannes Schubert,Dominik Rebholz

POKITE - Potenzial KI-gestützter Verfahren zur Ermittlung tourismusinduzierter Effekte auf Lebenszufriedenheit und Gemeinwohl

Ziel des Projekts war es, die nachhaltige Transformation der Tourismusbranche mit der Entwicklung innovativer Kennzahlen in der sozialen Nachhaltigkeitsdimension zu unterstützen. Anhand öffentlich verfügbarer Daten und mit Hilfe von Machine Learning (ML) sollte der Versuch unternommen werden, räumliche Muster im Zusammenspiel von Tourismus und sozioökonomischen Lebensverhältnisse zu erkennen – mit dem Ziel, alternative Erfolgsindikatoren jenseits von Betten- und Übernachtungszahlen zu identifizieren und den Aufbau einer umfassenderen und objektiven Planungs- und Entscheidungsgrundlage für die nachhaltige Destinationsentwicklung zu unterstützen.
Mehr zum Projekt und den Projektergebnissen finden sich hier.
Das Projekt POKITE wurde vom Bayerischen Zentrum für Tourismus e. V. gefördert
Laufzeit: 01.11.2023 bis 30.10.2024
Ansprechpartner am INIT: Dr. Johannes Schubert

Studie zu Tourismusbewußtsein, -akzeptanz und Lebenszufriedenheit im Allgäu
Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung im Allgäu
Das Hauptziel der Studie war eine Wahrnehmungsmessung der Tourismusakzeptanz und der tourismusinduzierten Lebensqualität innerhalb der örtlichen Bevölkerung des Allgäus. Weiterhin sollte ermittelt werden, wie sich aus Sicht der lokalen Bevölkerung der Tourismus im Allgäu in Zukunft weiterentwickeln sollte, welche Störfaktoren reduziert bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um der (mancherorts) zunehmenden Belastung durch den Tourismus entgegenzuwirken.
Mehr Informationen zur Studie und den Ergebnissen finden Sie hier
LIFT Wissen
Analysen und Strategien zur Wiederbelebung und langfristigen Erfolgssicherung des Tourismus

Wie müssen sich touristische Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig aufstellen, um dem durch die Corona-Pandemie möglicherweise veränderten Reiseverhalten erfolgreich zu begegnen? Dieser Frage ist das Konsortium aus deutschlandweiten Partnern unter Koordination von C.I.S.T (Center for innovation & Sustainability in Tourism) nachgegangen, zu dem das Insitut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) der Hochschule Kempten, das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT), die LMU München und das Deutsche Institut für Tourismusforschung der Fachhochschule Westküste gehörten.
Weitere Informationen und den Abschlussbericht finden Sie auf der Seite des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes oder im Artikel der B4B Wirtschaftsleben Schwaben vom 27.04.2022.
Pressemitteilung der Hochschule vom 22.04.2022: Re-Start im Tourismus: Berührungsarmes Reisen, minimierte Risiken, größere Angebotspalette und offene Kommunikation
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Alfred Bauer
Dr. Sabrina Brey
Dr. Johannes Schubert
Evaluierung RÖFE
Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen

Seit vielen Jahren fördert das StMWi mit dem Programm RÖFE öffentliche touristische Infrastruktureinrichtungen. Mit dem Programm wurden seither zahlreiche Einrichtungen modernisiert, erweitert oder erhalten. Im Rahmen einer Studie wurde nun die Wirkung der Förderung für den Tourismus in Bayern für die Jahre 2007 bis 2020 analysiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Schwerpunkt der Förderung überwiegend im ländlichen Raum sowie in Gebieten mit besonderem Handlungsbedarf lagen und Tourismusförderung somit vielfach auch Strukturförderung bedeutet, die Impulse für bedarfsgerechete Veränderungen und Innovationen setzt.
Weitere Informationen und alle Ergebnisse finden Sie im Abschlussbericht der Studie.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Alfred Bauer
Martina König
Christiaan Niemeijer

Low- & No-Touch Tourism
Projektpartner: Universität Augsburg
Noch immer leidet die Tourismusbranche unter den pandemie-bedingten Einschränkungen. Die Branche sucht nach innovativen Ideen, um dem Gast sichere und kontaktarme Angebote machen zu können. Der Bereich von „low touch tourism“ oder gar „no touch tourism“ könnten hier alternative und interessante Perspektiven bieten.
In Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg untersucht das Pilotprojekt "Low- & No-Touch Tourism" zunächst Konzepte zur Vermeidung von Gruppenbildung, wie beispielweise raumzeitliche Tracking- und Navigationssysteme zum Vermeiden von Crowding-Effekten, wirksame Strategien zur Reduzierung von Schlangenbildungen, Wartezeiten und Stauungen (flow improvement) oder bestehende Formen des low touch travel (begegnungsarmes Reisen). Gleichermaßen nimmt das Projekt die Minimierung physischer Kontakte zwischen Reisenden und Tourismusanbietern in den Fokus.
Ziel des Pilotprojektes ist die Sammlung, Strukturierung und Diskussion von Informationen, Daten und Erfahrungen zum low- und no-touch tourism. Darauf aufbauend werden sowohl Empfehlungen für die weitere forschungsseitige Thematisierung sowie andererseits Vorschläge für die weitere praxisorientierte Umsetzung dieser Konzepte erarbeitet. Dabei kann es beispielsweise um Fragen gehen, wie trotz kontaktarmer Angebote eine persönliche Bindung zum Gast aufgebaut werden kann oder wie persönliche (regionalkulturelle) Urlaubserlebnisse kontaktarm möglich sein könnten. Auch Fragen nach den nötigen low touch skills von Mitarbeiter(innen) im Gastgewerbe, der Akzeptanz berührungsarmer Angebote bei den Reisenden oder dem Marketing solche Konzepte im Rahmen des touristischen Destinationsbrandings könnten sich ergeben.
Erste Ergebnisse präsentierte PD Dr. Markus Hilpert von der Universität Augsburg im Rahmen des Jahresdialoges 2021 „Wie tickt der Tourist?“ vom Bayerischen Zentrum für Tourismus am 20. Mai 2021.